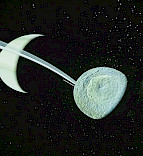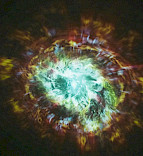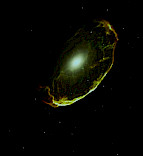OPERN.NEWS, 01.11.2022, Walter Weidringer
Die Kompanie sirene Operntheater realisiert René Clemencics hebräisches Oratorium «Kabbala» mit astronomischen Projektionen in der Kuppel des Planetariums im Wiener Prater.
Mit einem dumpf grollenden Paukenwirbel fängt alles an. Er schwillt bedrohlich an, bis am Höhepunkt ein elementarer Aufschrei daraus hervorbricht: eine signalhafte Dissonanz des Blechs, gebildet durch zwei Töne der Posaunen im Sekundabstand. Rein intuitiv sei dieser Beginn damals entstanden, hat mir René Clemencic einmal erzählt: Ich werde in diesem Text immer wieder aus diesem 2008 geführten Gespräch zitieren. Zu deuten habe er ihn erst später vermocht: „Der Buchstabe Beth (ב) vertritt die Zahl 2, die Zahl unserer Welt: Bei uns ist alles bipolar Mit ihm beginnt auch die Bibel: ‚Bereschit‘, ‚Im Anfang‘. Das Aleph (א) davor, mit dem das Alphabet beginnt, die Eins, liegt vor unserer begreifbaren Existenz. Es hat keinen Laut, ist nur ein Hauch, existiert physisch eigentlich gar nicht. Gut, es kann ein Vokal unterlegt werden, aber … Man stelle sich vor: Der Beginn, die Grundlage der Buchstabenreihe ist eigentlich nicht vorhanden. Sehr merkwürdig, nicht? Und grandios!“
«Kabbala oder: Die vertauschten Schlüssel zu den 600.000 Gemächern des Schlosses»: So heißt Clemencics Oratorium in hebräischer Sprache, das der im vergangenen März 94-jährig verstorbene Komponist, Dirigent und Alte-Musik-Experte vor 30 Jahren geschaffen hat. Laut der Kabbala, wörtlich „Überlieferung“, also der jüdischen Mystik, soll es sich mit dem Geheimnis Gottes verhalten wie mit einem Schloss, in dem vor dessen 600.000 versperrten Zimmern jeweils ein Schlüssel läge – aber überall der falsche. Was im Grunde uninszenierbar ist, wird in dieser Produktion des sirene Operntheaters (Jury Everhartz, Claudia Haber, Angelika Pointner) in Zusammenarbeit mit Planetarium, Volkshochschule und Wien Modern denn auch mit filmischen Mitteln visualisiert, geschaffen von einem Astronomie- und Animationsteam (Michael Feuchtinger, Konstantin Kirner, Hannes Richter, Germano Milite; Dramaturgie: Kristine Tornquist) und projiziert in die Kuppel zur Liveaufführung der Musik.
Wer in die Tiefe des Menschen hinabspähen will, richtet die Augen zugleich in die Höhe: Oben und unten, Makro- und Mikrokosmos entsprechen einander, sagt die Kabbala. Also schauen wir auch den Menschen, wenn wir den Kopf in den Nacken legen und die Unendlichkeit des Alls zu ergründen versuchen. Und womit sonst sollte eine mystisch-wissenschaftliche, musikalisch bildhafte Reise im Planetarium Wien auch sonst beginnen als mit dem Blick hinauf in den Sternenhimmel, auf das „Rückgrat der Nacht“? So haben die San im südlichen Afrika das diffus leuchtende Band genannt, das sich zwischen all den anderen Lichtpunkten über das Firmament hinzieht: die Milchstraße. Erst Galileo Galilei sollte sie als Sternenansammlung identifizieren können, unsere Galaxie, mit Spiralarmen in Form eines leicht verbogenen Rades und kugelähnlichem Zentrum.
Am umringenden Horizont, dort, wo die Projektionskuppel auf der Wand aufsitzt, werden bald Wasserwellen sichtbar – so, als würde man nachts im Ozean schwimmen. Die Wellen steigen und verwandeln sich in ein Band, das gen Himmel entschwebt und dort weiterwabert, bis ein zweites nachfolgt, schlingert, sich zum Zeichen der Unendlichkeit verdreht. Eine gute Stunde später, gegen Ende, werden diese Wasserringe ihr Pendant im Feuer finden, in der visuell fassbar gemachten Sonnenoberfläche mit ihren Protuberanzen. Dazwischen, gegliedert in die zehn Kapitel der Partitur: Aufschlüsselungen des Urknalls, Reisen durch Molekülwolken und pittoreske astronomische Nebel, Supernova-Explosionen. Und beim schnittigen Kurven durchs Sonnensystem bekommen selbst Hartgesottene weiche Knie, weil ihnen der Bezugspunkt verloren geht und sich nicht mehr die Bilder bewegen, sondern das ganze Planetarium sich in ein fliegendes Raumschiff verwandelt ...
„Die Ursprache Hebräisch, in welcher jeder Buchstabe in wesensmäßiger Einheit zugleich Zahl, Zeichen und Laut ist“, so war Clemencic überzeugt, „ist wie keine andere geeignet, uns die notwendigerweise verlorenen Schlüssel zu den Türen des Lebens finden zu lassen.“ Die Mehrschichtigkeit des Textes, die Zahlensummen, die sich aus Wörtern ergeben, die daraus erwachsenden Querverbindungen: ungeheure Aufschlüsse, die ergründet sein wollten. Zunächst in aufwendigen Selbststudien, später dann mit Unterstützung aus Israel, eignete sich Clemencic das Hebräische in Wort und Schrift an, um die Originale studieren zu können – und war schließlich „überglücklich durch die Begegnung mit dieser Welt, in der so viel Tiefes verborgen liegt.“
Das Libretto hat er selbst zusammengestellt – aus Tora und natürlich Kabbala. Das Werk zeichnet den Pfad des Menschen und der Welt nach, mit allen wichtigen Umwegen, die unsere Existenz formen, wobei das notwendige Innehalten immer wieder in Klangmeditationen seinen Ausdruck findet. „Die Kabbala und das Hebräische beschreiben allgemein Menschliches, nicht bloß Jüdisches – das wäre viel zu beschränkt.“ Am Ende stehen die Worte: „Ajin Sof Or, Ajin Sof, Ajin“ – und Clemencic erklärt: „Ajin heißt: nichts. Oder: unendlich! Also: ‚Unendliches Licht, unendliche Weisheit, Nichts.‘ Alles geht wieder ins Nichts zurück, dorthin, wo es hergekommen ist.“
Das Hebräische basiert auf einem Konsonantenalphabet, Vokale fehlen normalerweise: Man muss die Worte einfach auch so wiedererkennen, um sie lesen und verstehen zu können. „Und eigentlich dürfte man die Bibel gar nicht mit Vokalzeichen, den sogenannten masoretischen Zeichen, versehen.“ Dadurch würde nämlich die Bedeutung des heiligen Textes auf unzulässige Weise eingeengt und festgelegt. Umgekehrt kann aber die gleiche Konsonantenkombination natürlich verschiedene Wörter meinen: Wir können uns also nur über Auslegung und Diskussion ans Absolute annähern, nicht aber es festnageln, weil wir zwischen den widerstreitenden Polen unserer Welt gefangen sind. Die Janusköpfigkeit der Existenz spiegelt sich freilich auch im erwähnten Zusammenfallen von Unendlichkeit und Nichts. „Die hebräische Mystik ist nicht Nebuloses, Verschwommenes“, betont Clemencic, „im Gegenteil: Man hat das Gefühl, zur eigentlichen Wirklichkeit vorzudringen, Zusammenhänge zu erkennen, die viel realer und klarer sind als jene banalen in der Alltagswelt.“ Die mündliche Überlieferung all dieses Wissens basiert freilich auf Lauten, auf Klang – und damit sind wir schließlich wieder bei der Musik und der aktuellen Aufführung.
Unter der Leitung von François-Pierre Descamps machten in der allerdings widrigen, weil extrem trockenen, alles schluckenden Akustik des Planetariums fünf Männerstimmen von Countertenören bis zum Bassbariton (Bernhard Landauer, Nicholas Spanos, Gernot Heinrich, Richard Klein, Colin Mason), Blechbläser (Gerald Grün, Werner Hackl, Peter Kautzky, Christian Troyer) und reichhaltiges Schlagzeug (Robin Prischink, Adina Radu) Clemencics Werk lebendig – nicht perfekt, vielleicht auch durch das notgedrungen schummrige Licht bedingt, aber eindringlich.
„Kabbala“ kehrt das Alte am Neuen und das Neue am Alten hervor, entfaltet kultische Kraft – und zeigt, wie nahe archaische Homo-, Hetero- und früheste Polyphonie, synagogaler Gesang und etwa die Signale des Schofar neuerer Minimal Music kommen können. Die seiner Komposition zugrundeliegenden musikalischen Gestalten (wie etwa Rhythmen) hat René Clemencic auf mannigfaltige Weise aus den Texten abgeleitet – ist doch jeder Buchstabe auch Zahl, jedes Wort eine Zahlenkombination. „In der kabbalistischen Tradition der Lautmeditation soll der Geist über ‚sinnlose‘ Lautkombinationen vom Kausaldenken befreit und offen werden. Das Tetragrammaton des Namen Gottes (JHWH, meist als Jahwe oder Jehova ausgeschrieben), gebildet aus den vier Konsonanten Jod (י), He (ה), Waw (ו)und He (ה), durchläuft im Oratorium eine lange Reihe von Vokalpermutationen. Die Zahlenbedeutungen sind 10, 5, 6, 5 – die 10 als Potenzierung der 1; sie zerfällt in zweimal 5, die Polaritäten des Daseins, die aber durch den Haken des Waw (6) verbunden werden: Wir haben es nicht mehr mit Einheit, sondern mit einer Geteiltheit zu tun, die wir wieder zusammenfügen müssen, um die Einheit wieder zu gewinnen.“ Noch ein faszinierendes Detail fügte Clemencic damals hinzu: „Die Zahlensummen der Wörter‚Messias‘ und ‚Schlange‘ sind identisch, die beiden Begriffe bedingen einander gegenseitig: kein Messias ohne Schlange und umgekehrt!“
Mit der zentralen Bedeutung von Zahlen, Tonsymbolen und Tonbuchstaben in seiner Musik stellte sich René Clemencic bewusst in eine lange Reihe von Komponisten und Theoretikern von Pythagoras bis zur Wiener Schule. „Musik ohne Zahl wäre völlig undenkbar. Ich will mein Material gewinnen, nicht erfinden: Die Dinge sind ja da, und ich hole sie mir einfach.“ Die Gleichzeitigkeit von Gegenwärtigem und scheinbar Vergangenem, das aber weiter vorhanden und präsent bleibt, prägte ja Clemencic auch in seiner Funktion als Spezialist für Alte Musik. Seit «Kabbala» beruhte seine Kompositionstechnik ganz auf den darin erprobten Prinzipien. Dass Rationalität und Mystik einander jedoch nicht widersprechen, belegte der Komponist mit einem weiteren merkwürdigen Erlebnis, über das er zwar lachen konnte, bei dem ihm „aber doch ganz anders geworden“ sei: Als er eines der letzten Worte der Partitur niederschrieb, „Jeruschalajm“, schrillte plötzlich das Faxgerät. „Ich fühlte mich momentan gestört, denn ich erhalte nur alle paar Jahre ein Fax.“ Es kam aus Jerusalem.
Jedenfalls: ein kurzer, lohnender Abend der Wunder, Rätsel und Riten, mit sechs Folgeaufführungen bis zum 19. November. Zum Auftakt gibt es dabei wechselnde Vorträge zu verschiedenen Themen rund um Kabbala, Wissenschaft und Glauben. Vor der Premiere sprach der Judaist Klaus Davidowicz zum Golem – nicht ganz unpassend zu Halloween, zumal Menschen aller Altersgruppen, teilweise in Verkleidung, durchs Pratergelände strömten.